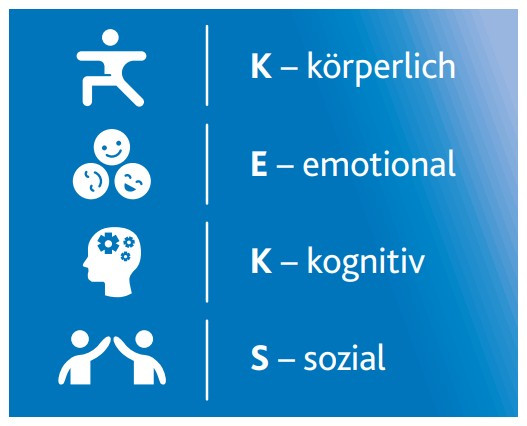Planung einer Sportstunde
Als Übungsleiter*in oder Trainer*in solltest du deine Sportstunden planen und zielgerichtet gestalten. Ziel ist es, dass du eine Übungsstunde strukturiert planst, sodass du die Ziele der Stunde optimal erreichst. Hierfür helfen dir auch die einzelnen Phasen einer Sportstunde.
Wenn du dir vor jeder Sportstunde Gedanken dazu machst, wie du sie gestaltest, kannst du die Qualität der Stunde maßgeblich verbessern. Außerdem entlastet dich eine gute Planung bei der Durchführung und ermöglicht es dir, Anpassungen vorzunehmen. Dazu solltest du möglichst viele Szenarien, die in einer Sportstunde auftreten können, vorwegnehmen. Dies bietet dir Handlungsalternativen, um Spiele und Übungen anpassen zu können. Plane beispielsweise Alternativen für mehr oder weniger Teilnehmende oder für Progressionen und Degressionen – also verschiedene Schwierigkeitsstufen.
Stundenplanung ist die „gedankliche Vorwegnahme“ aller Entscheidungen, die für deine Sportstunde wichtig sind. Konkret geht es unter anderem um das Festlegen des Stundenziels und das Planen der Inhalte und Methoden. Darüber hinaus schließt die Stundenvorbereitung auch das Bereitstellen sämtlicher Materialien ein, die für die Übungsstunde benötigt werden, wie Bälle, Seile, Bänke, Hütchen und Hanteln.
Bedingungsanalyse
Bevor du deine Stunde planst, musst du dich damit auseinandersetzen, welche Rahmenbedingungen dir zur Umsetzung der Stunde vorliegen (Bedingungsanalyse). Bei dieser Analyse solltest du dir Gedanken zu den Teilnehmer*innen machen, die deine Sportstunde besuchen werden. Dies hilft dir dabei, die Ziele, Inhalte und Methoden deiner Sportstunde auf die Teilnehmer*innen auszurichten. Diese Analyse ist die Grundlage für deine Stundenplanung. Die folgenden Fragen sollen dir dabei helfen, deine teilnehmerbezogenen Rahmenbedingungen zu definieren.
Teilnehmerbezogene Rahmenbedingungen
- Anzahl
- Wie viele Teilnehmer*innen erwarte ich?
- Soziokulturelle Merkmale
- Wie alt sind die Teilnehmer*innen?
- Welches Geschlecht haben die Teilnehmer*innen?
- Welche sozialen oder kulturellen Hintergründe der Teilnehmer*innen könnten von Bedeutung sein?
- Welche Sprachbarrieren könnten auftreten?
- » Voraussetzungen
- Welchen Leistungsstand haben die Teilnehmer*innen?
- Welche Motive und Motivation haben die Teilnehmer*innen?
- Welche sportlichen Ziele verfolgen die Teilnehmer*innen?
- Welche Methoden, Spiel- und Übungsformen sind den Teilnehmer*innenbekannt?
- Wie ist der Gesundheitsstand der Teilnehmer*innen?
Zur weiteren Stundenvorbereitung musst du dich mit den räumlichen, materiellen und rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Diese Rahmenbedingungen zeigen dir, welche Möglichkeiten dir geboten sind, die Stunde zu planen und umzusetzen. Die folgenden Fragen sollen dir helfen, deine räumlichen, materiellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu definieren.
Räumliche, materielle und rechtliche Rahmenbedingungen
- Welche Sporträume und -materialien stehen zur Verfügung?
- Was können die Teilnehmer*innen mitbringen?
- Welche rechtlichen Vorgaben existieren in meinem Sportverein?
Ziel, Inhalt und Methode
Auf Grundlage deiner Bedingungsanalyse geht es in deiner Stundenplanung darum, Ziele und Inhalte festzulegen sowie grundlegende methodische Entscheidungen zu treffen. Insbesondere aus trainingswissenschaftlicher Sicht, sollten die Inhalte und Methoden sich an einem zuvor definierten Stundenziel orientieren. Dies bedeutet für dich, dass du zuerst das Ziel deiner Sportstunde definierst und anschließend die Inhalte und Methoden planst